Lernwerkstätten
Jugendliche, die eine besondere pädagogische Unterstützung benötigen, weil sie von der Schule nicht mehr erreicht werden, dort aufgrund ihres Verhaltens nicht länger unterrichtet werden können oder besonderen sozialen Gefährdungen ausgesetzt sind, wird in Tagesheimen oder von Trägern der Jugendsozialarbeit ein ‚alternatives‘ Lernsetting angeboten. Zumeist werden voll- oder teilzeitschulpflichtige Jugendliche und junge Erwachsene im Alter zwischen 14 und 20 Jahren aufgenommen, die aus verschiedenen Gründen in Regelschulen gescheitert sind (Verweigerung, Abschulung aufgrund von Gewalttaten oder Drogenkonsum). Die Zuweisung zu den Projekten erfolgt hauptsächlich durch Meldung einer Schule über die Schulbehörden und das Jugendamt. Teilweise geht die Initiative aber auch von den Jugendlichen selbst oder ihren Eltern aus. Ziel ist es, von der Schule abgewandte Jugendliche, die zum Teil über Monate und Jahre der Schulpflicht nicht nachkommen konnten oder diese nicht erfüllen wollten, wieder an einen geregelten, strukturierten Alltag zu gewöhnen.
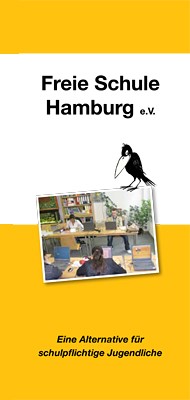
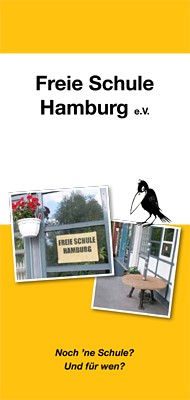
Eine der ältesten Lernwerkstätten Deutschlands, gegründet 1983 [dazu: Schroeder 2002]
Überwiegend sind es Jugendliche, für die in der aktuellen Lebenssituation der Erwerb eines Schulabschlusses unerreichbar geworden ist. Oftmals können sie aufgrund der gesundheitlichen oder sozialen Situation nicht regelmäßig am Unterricht teilnehmen, denn sie müssen Termine in der Therapie, auf Ämtern oder bei Gericht wahrnehmen, sich für längere Zeit in einen Drogenentzug oder in den Jugendarrest begeben, es gibt familiäre Verpflichtungen, manchmal ist ein eigenes Kind zu versorgen. Auch an die Jobs oder Arbeitsverhältnisse, in die die Teilnehmenden eingebunden sind, muss sich das Lernangebot anpassen. Ein Unterricht nach Stundenplan, zu festen Zeiten am Tag oder in der Woche, kann zumeist nicht stattfinden, sondern es müssen mit den Zeitmustern der Schülerinnen und Schüler abgestimmte, individuelle Bildungsangebote unterbreitet werden.
Fast immer setzt sich das pädagogische Team aus Lehrkräften sowie sozial- und werkpädagogischem Fachpersonal zusammen. Es ist in der Regel ganztägig in der Schule anwesend und steht für Einzel- oder Gruppenarbeit, Beratungs- und Betreuungstätigkeiten zur Verfügung. Im Unterschied zu den (→) Produktionsschulen geht es in den Lernwerkstätten zuvörderst um die intensive Förderung des Sozialverhaltens der Jugendlichen, die Vermittlung arbeitsweltorientierter, gar berufsqualifizierender Kompetenzen sind dem nachgeordnet. Die Reintegration in die Herkunftsschule gelingt oftmals nicht.
Demgegenüber sind die Unterbrechung der Teilnahme an und eine Rückkehr in die Lernwerkstatt häufig problemlos möglich, es steht den Jugendlichen – wenngleich in von den Behörden gesetzten Grenzen – offen zu entscheiden, wie lange sie in der Einrichtung bleiben möchten. Es gibt nicht wenige, die nur einige Monate in den Bildungsangeboten sind, dann einen Job finden, in eine weiterführende Schule vermittelt werden oder aus den verschiedensten Gründen den Schulbesuch abbrechen müssen. Unterbrechung führt aber, anders als in Regelschulen, nicht zum Schulausschluss. Denn die Bildungsangebote sind überwiegend nicht abschlussorientiert, vielmehr steht die Reintegration in der Regelschulen oder die Vermittlung in Jobs im Vordergrund.
Die Angebote für schulferne Jugendliche kennzeichnet eine Kombination aus sozialpädagogischer Betreuung und Förderung sowie schulischem Lernen. Durch die Herstellung stabiler Beziehungen sollen neue Lernerfahrungen geboten werden, erlebnispädagogische Aktivitäten sind zumeist ein wichtiger Bestandteil. In der Regel werden neue Lernorte geschaffen, so dass es den schulfernen Kindern und Jugendlichen möglich wird, räumliche Distanz zur Schule als dem Ort des bisherigen Versagens zu halten. Dieser Ansatz wird oftmals kritisiert, der außerschulische Lernort gilt als isolierter Schutzraum, der einen erfolgreichen Wiedereinstieg in den regulären Schulalltag eher verhindere als erleichtere. Die Herkunftsschulen sehen solche Lernangebote aber durchaus als Entlastung an.
Die curriculare Struktur umfasst zum einen allgemeinbildende Fächer, die als „Paukkurse“ in Kompaktform angeboten werden, orientiert an zuvor festgelegten Lernzielen, die die einzelnen Jugendlichen oder die Kleingruppen erreichen sollen oder wollen (Mathematik, Deutsch, Gesundheit, Hygiene, Ernährung). Ein zweiter Lernbereich bezieht sich auf die Erfordernisse der Alltagsbewältigung. In geringem Maße werden hierzu ebenfalls Kurse angeboten, hauptsächlich wird dies jedoch in einer Abfolge zu erledigender Besorgungen unterrichtet, so dass auch die Begleitung zu Ämtern oder die Berücksichtigung individueller Betreuungserfordernisse möglich werden. Ein dritter Lernbereich sind Projekte, an denen sich möglichst viele Jugendliche beteiligen sollen. Häufig halten die Einrichtungen musisch-ästhetische Werkstätten (Holz, Metall, Töpferei, Fotolabor, Videoschnittraum, Geschichtswerkstatt) vor, die individuell beziehungsweise in Kleingruppen genutzt werden, oder die Jugendlichen können an den dort angebotenen Kursen und Veranstaltungen teilnehmen. Auf diese Weise wird auch ein vierter Lernbereich zur Freizeitorientierung durchgeführt: Da sich das Leben der Jugendlichen oftmals am Rande von Arbeitslosigkeit, Depression, beengten Wohnverhältnissen, erstarrten Familienstrukturen und Perspektivlosigkeit abspielt, sind Möglichkeiten zur anregenden Freizeitgestaltung von zentraler Bedeutung. [Reiser/Loeken 1993; Schroeder 2002; Herz 2006; www.freie-schule-hamburg.de]
Über die Zahl der in Deutschland vorhandenen Lernwerkstätten für unterrichts- und schulverweigernde Jugendliche ist wenig bekannt. In Nordrhein-Westfalen gab es 2008 mehr als einhundert Schulmüdenprojekte [LVR 2010]. Auf der Grundlage statistischer Angaben in diversen Dokumentationen zu „Best practice“ ist mit mindestens eintausend solcher Angebote in der Bundesrepublik zu rechnen [Schreiber-Kittl 2000; DJI 2005; Kobra.Net 2013]. Bei durchschnittlich zehn Teilnehmenden pro Projekt kommt man auf zehntausend Jugendliche, die betreut werden, wahrscheinlich sind es deutlich mehr. Auch die geschichtliche Entwicklung dieses Schultyps lässt sich nur lückenhaft rekonstruieren. Vermutlich liegen die Wurzeln in frühen Versuchen der Erziehungshilfe mit so genannten Kleinklassen, in denen, angegliedert an Regel- oder Sonderschulen, ‚schwierige‘ Schülerinnen und Schüler zusammengefasst und von einem kleinen pädagogischen Team intensiv betreut und unterrichtet wurden. Eine andere historische Entwicklungslinie dürfte in der zunehmenden Auflösung der geschlossenen Heimschulen für erziehungsschwierige Kinder und Jugendliche liegen, verknüpft mit dem Versuch, ambulante und familiennahe Bildungsangebote zu schaffen. Diese strukturellen Veränderungen in Verbindung mit der Konzipierung ‚neuer‘ oder der Wiederentdeckung ‚alter‘ pädagogischer Arbeitsansätze (Projektunterricht, Arbeitserziehung, soziales Training, ästhetische Pädagogik mit benachteiligten Jugendlichen) führten nach und nach zur Herausbildung spezifischer Konzepte der Lernwerkstatt, die sich jedoch sehr voneinander unterscheiden. Gleichwohl fällt auf, dass es zwar jede Menge Studien zum Phänomen Schulverweigerung gibt, aber so gut wie keine empirischen Untersuchungen zu den Lernwerkstätten vorhanden sind [Weckel/Grams 2017].
DJI - Deutsches Jugendinstitut (2005): Nicht beschulbar? Gute Beispiele für den Wiedereinstieg in systematisches Lernen. Dokumentation. München: DJI. – Herz, Birgit (2006): Du kannst nicht immer gewinnen!" Das Projekt Jugend mit Perspektive: Ein Hamburger Modell zur Integration bildungsbenachteiligter junger Menschen in die Arbeitswelt. Münster: Waxmann. – Kobra.Net (2013): Bildungsangebote für Schulverweigerer erfolgreich gestalten. Datenbasierte Erkenntnisse und Erfahrungen der Landeskooperationsstelle Schule-Jugendhilfe Brandenburg. Potsdam: Kobra.Net. – LVR - Landesjugendamt Rheinland und Landesjugendamt Westfalen (2010): Beratungsstellen, Jugendwerkstätten und Schulmüdenprojekte. Auswertung der Jahresstatistik 2008. Köln/Münster. – Reiser, Helmut; Loeken, Hiltrud (Hrsg.) (1993): Das Zentrum für Erziehungshilfe der Stadt Frankfurt am Main. Kooperation von Schule und Jugendhilfe. Solms: Jarick Oberbiel. – Schreiber-Kittl, Maria (Hrsg.) (2000): Lernangebote für Schulabbrecher und Schulverweigerer. München: Deutsches Jugendinstitut. – Schroeder, Joachim (2002): Eine Alternativschule für gescheiterte Jugendliche. In: ders. Bildung im geteilten Raum. Schulentwicklung unter Bedingungen von Einwanderung und Verarmung. Münster: Waxmann, 217-228. – Weckel, Erik; Grams, Meike (2017): Schulverweigerung: Bildung, Arbeitskraft, Eigentum. Eine Einführung. Weinheim/Basel: Juventa.