Minderheitenschulen
In der 1919 beschlossenen Verfassung der Weimarer Republik war in Artikel 113 ein Selbstbestimmungsrecht für Minderheiten verankert worden, dass sich insbesondere auch auf den schulischen Bereich bezogen hat [Lukaschek et al. 1930; Krüger-Potratz et al. 1998]. In vielen Ländern Europas gab und gibt es bis heute sprachliche, kulturelle, ethnische und/oder religiöse Minderheiten, die von der Mehrheitsgesellschaft oftmals politisch und rechtlich unterdrückt sind. Im Bildungsbereich versuchen Minderheiten deshalb mit (→) Untergrundschulen ihren Kindern im Geheimen ihre Sprache, ihre Geschichte und Kultur zu vermitteln. Minderheitenschulen beruhen hingegen auf einem gesetzlich zugestandenen Recht auf Selbstbestimmung. Die Minderheitenschulen der Weimarer Republik, von denen manche bis heute in Deutschland fortbestehen, gehören somit zu den weltweit verbreiteten (→) Indigenen Schulen für autochthone Minderheiten, also Bevölkerungsgruppen, die ‚schon immer‘ in ‚angestammten‘ Siedlungsgebieten innerhalb eines nationalstaatlichen Territoriums leben. Die im Deutschen Reich (mit Vorläufern) im Wesentlichen nach dem Ersten Weltkrieg geschaffenen verfassungsrechtlichen Grundlagen wurden in der DDR und in der BRD in Teilen übernommen und gestehen auch seit der Wiedervereinigung den in Deutschland lebenden dänischen, friesischen und sorbischen Minderheiten sowie Sinti und Roma weiterhin eigene Schulen zu. [BMI 2020]
„Die fremdsprachigen Volksteile des Reiches dürfen durch die Gesetzgebung und Verwaltung nicht in ihrer freien volkstümlichen Entwicklung, besonders nicht im Gebrauch ihrer Muttersprache beim Unterricht sowie bei der inneren Verwaltung und der Rechtspflege beeinträchtigt werden“ (Art. 113 der Verfassung des Deutschen Reiches vom 11. August 1919, zit. nach Hubrich 1927, S. 9). Politisch umstritten war in der Weimarer Republik jedoch, wem ein Minderheitenstatus zuerkannt werden soll: Friesisch, Kaschubisch und Masurisch waren schon länger anerkannte Minderheitensprachen, wurden aber nicht in Artikel 113 einbezogen. Die überwiegend in Bayern lebende tschechisch-sprachige Bevölkerung hatte keine eigene zur Anerkennung des Minderheitenstatus geforderte Minderheitenorganisation gegründet, und der Freistaat Bayern hatte sich in seiner Verfassung als Land ohne Minderheit definiert. Die jüdischen Verbände lehnen es bis heute ab, sich als „fremdsprachige Volksteile“ bezeichnen zu lassen, sondern verstehen sich als Glaubensgemeinschaft. Ohne große Diskussion wurden in der Weimarer Republik auch „die Zigeuner“ ausgeschlossen, denn sie galten als „umherziehende“, somit nicht als „bodenständige Minderheit“, außerdem hatten sie kein abgrenzbares regionales „Siedlungsgebiet“. Letztlich wurde den im Herzogtum Schleswig lebenden Dänen, den in der Lausitz siedelnden Sorben (Wenden), der litauischen Bevölkerung in Ostpreußen sowie den Polen in Oberschlesien der Minderheitenstatus zugesprochen. [Krüger-Potratz et al. 1998, S. 85-111]
Alle anerkannten Minderheiten lebten somit überwiegend in Preußen, sodass die konkrete Ausgestaltung der Minderheitenschulen in der Verfassung des Freistaats Preußen vom 30. November 1920 niedergelegt ist. Artikel 73 sah die Möglichkeit vor, den Unterricht in der Sprache der „fremdsprachigen Volksteile“ zu erteilen, erweiterte dies jedoch um die Bestimmung, dass auch „für den Schutz deutscher Minderheiten zu sorgen ist“, was sich beispielsweise auf manche Gegenden in Ostpreußen bezogen hat [Hubrich 1927, S. 13]. Das „Gesetz betreffend die Regelung der Selbständigkeitsrechte der Provinz Oberschlesien“ vom 25. Juli 1922 legt in den Artikeln 105 bis 108 besonders ausführlich die drei Möglichkeiten zur Organisation der selbstbestimmten Schulbildung fest: (1) Die Einrichtung einer Minderheitsschule, wenn mindestens 40 reichsangehörige Kinder einer sprachlichen Minderheit dies beantragen; die Minderheitensprache (Polnisch) wurde dann die Unterrichtssprache. Die Minderheitsschulen durften wieder aufgelöst werden, wenn ihre Schülerzahl in drei aufeinanderfolgenden Schuljahren unter diesen Richtwerten blieb. (2) Minderheitsklassen, die an Volksschulen mit der Staatssprache (Deutsch) eingerichtet werden durften, wenn mindestens 18 Schülerinnen und Schüler dies wollten. (3) Ein Minderheitsunterricht, begrenzt auf das Lesen und Schreiben und/oder Religionsunterweisung in der Minderheitssprache bei mindestens zwölf Kindern. Artikel 118 sieht diese drei Formen auch für alle höheren Schulformen vor. Ähnliche Erlasse gab es für die litauische, wendische (sorbische) und dänische Sprache, die Bestimmungen wichen lediglich im Detail, nicht aber grundsätzlich von denen für das Polnische ab [Hubrich 1927, S. 32-34, 39-41, 63-70].
Diese an und für sich weitgehenden Rechte wurden aber oftmals nicht umgesetzt. Versuche zur Schaffung eines übergreifenden Reichsminderheitenschulgesetzes scheiterten, auch, weil sich die Minderheitenpolitik der Weimarer Republik nicht so sehr als eine fortschrittliche Übernahme internationalen Minderheitsrechts erwies, sondern „eine Geschichte fortdauernder, konfliktreicher Auseinandersetzungen und immer wiederkehrender Diskriminierungen“ war [Krüger-Potratz et al. 1998, S. 395]: Die dänische Minderheit klagte über vielfältige behördliche Schikanen, wenngleich ihr Anliegen durchaus Beachtung fand. Für die sorbischen und litauischen Minderheiten wurden die Bestimmungen überhaupt nicht umgesetzt mit dem Argument, dass aufgrund der wirtschaftlichen Not nach dem Ersten Weltkrieg dafür kein Geld vorhanden sei. Häufig scheiterte die Umsetzung auch daran, dass nicht genügend Schülerinnen und Schüler zusammengekommen sind, in Einzelfällen wurden nicht mal Privatschulen zugelassen [ebd., 110]. Preußen war darauf bedacht, die Zahl der zu berücksichtigenden Minderheiten möglichst klein zu halten, das Minderheitenschulrecht auf bestimmte Gebiete zu begrenzen und möglichst wenige staatliche Minderheitenschulen einzurichten. So kämpften die polnischen „Streuminderheiten“ in Westfalen und im „Ruhrgebiet“ ebenfalls um eigene Minderheitenschulen, genehmigt wurden aber nur Privatschulen, und die polnischen Schulträger mussten für alle Kosten (Schulgebäude, Lehrkräfte) selbst aufkommen [Oenning 1991, S. 70-86].
Die nationalsozialistische Schulpolitik schließt alle ethnischen und religiösen Minderheiten aus den öffentlichen Schulen aus, belässt aber manchen zunächst das Recht auf Privatschulen. So durfte die dänische Minderheit ihre Schulen bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs weiterführen, obgleich sie zunehmender Repression ausgesetzt war. Hingegen wurden die sorbischen Minderheitenverbände, sorbischsprachige Zeitungen und auch das Sorbische als Unterrichtssprache verboten sowie sorbischsprachige Lehrkräfte aus dem Schuldienst entlassen [Hansen/Wenning 2003, S. 73 und 79]. Im besetzten Polen wurden hingegen für die polnisch-, ukrainisch- und russischsprachigen Kinder eigene öffentliche Schulen eingerichtet, in denen jedoch ausschließlich deutschsprachiger Unterricht erteilt wurde [Hansen 1996]. Die gesetzlichen Grundlagen zu den (→) Schulen für Sintizze und Romnja veränderten sich mehrfach wie auch die von jüdischen Minderheiten (→ Auswanderungsschulen, → Untergrundschulen).
In der heutigen Bundesrepublik Deutschland gibt es vier gesetzlich anerkannte nationale Minderheiten: die dänische Minderheit, die friesische Volksgruppe, die Deutschen Sinti und Roma sowie das sorbische Volk. Die Deutschen Sinti und Roma (Gatschkene Sinti de Roma) erhielten erst 1995 den Minderheitenstatus, und Romanes wurde als Minderheitensprache gemäß der Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen des Europarates anerkannt. Damit verbunden ist auch das Recht auf eine selbstbestimmte Schul- und Berufsbildung, dass ihnen jahrhundertelang verwehrt worden war (→ Schulen und → Berufsbildung für Sintizze und Romnja).
In Abstimmungen nach dem Ersten Weltkrieg entschieden sich die Bevölkerung Südschleswigs für Deutschland, die Menschen in Nordschleswig für Dänemark, sodass in den beiden Ländern jeweils eine dänische bzw. eine deutsche Minderheit lebt. In der „Kieler Erklärung von 1949“ wurden für beide Minderheiten analoge Rechte gewährleistet, zu denen unter anderem ein jeweils eigenes Schul- und Bildungswesen gehört. Der Dänische Schulverein unterhält in der Stadt Flensburg sowie in den Landkreisen Schleswig-Flensburg, Nordfriesland und Rendsburg-Eckernförde ein gut ausgebautes Schulsystem mit Kindergärten, Grundschulen, Gemeinschaftsschulen (zwei davon mit gymnasialer Oberstufe und eine mit Internat), und ihm obliegen auch die Erwachsenenbildung sowie die außerschulische Kinder- und Jugendarbeit. [BMI 2020, S. 18-27]
Die friesische Volksgruppe in Deutschland lebt an der nördlichen Westküste Schleswig-Holsteins (Nordfriesland) und im nordwestlichen Niedersachsen, insbesondere in Ostfriesland sowie im Landkreis Cloppenburg. Von großer Bedeutung für die Pflege der friesischen Sprache, Kultur und Geschichte ist seit 1965 das Nordfriisk Institut in Bredstedt als zentrale wissenschaftliche Einrichtung. Zudem besteht an der Universität Kiel seit 1950 eine Nordfriesische Wörterbuchstelle und eine Professur für Friesisch. Ein eigenes friesisches Schulsystem gibt es nicht, aber an mehreren staatlichen Schulen im nordfriesischen Sprachgebiet sowie an einzelnen Schulen der dänischen Minderheit wird das Friesische unterrichtet. [BMI 2020, S. 28-43]
Das sorbische Volk (Serbski lud) lebt traditionell in der Oberlausitz (Freistaat Sachsen) und in der Niederlausitz (Land Brandenburg). Neben der Bezeichnung Sorben wird vor allem in Brandenburg auch der ältere Begriff „Wenden“ offiziell verwendet. Bereits im frühen 19. Jahrhundert gab es sorbische Volksschulen. Die DDR förderte ebenfalls die Eigenständigkeit des sorbischen Volkes im kulturellen und schulischen Bereich, 1946 wurde in Radibor das sorbische Lehrerbildungsinstitut und 1955 an der Universität Leipzig das Sorbische Institut gegründet, beide Einrichtungen befinden sich inzwischen in Bautzen/ Budyšin und in Cottbus/ Chóśebuz. Seit der Wiedervereinigung im Jahre 1990 erfährt das sorbische Volk ebenfalls einen besonderen Schutz. In Sachsen und Brandenburg gibt es in Gebieten, in denen Sorben leben, Schulen mit zweisprachigem Unterricht (Sorbisch/Deutsch) und Schulen, an denen Sorbisch als Fremdsprache gelehrt wird, in beiden Bundesländern sind überdies mehrere sorbische Kindergärten vorhanden. [BMI 2020, S. 53-67]
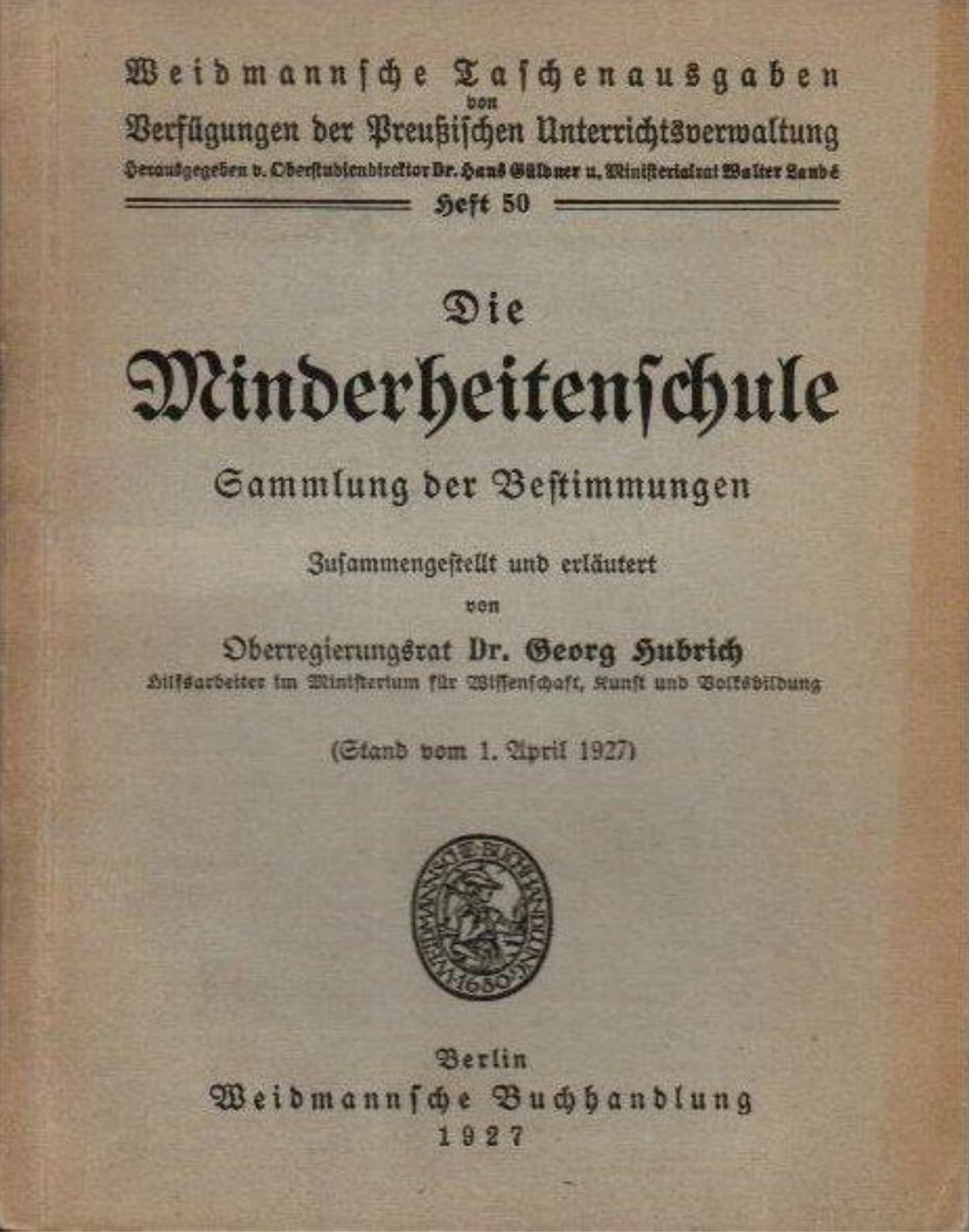
BMI - Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (2020): Nationale Minderheiten, Minderheitensprachen und die Regionalsprache Niederdeutsch in Deutschland. Berlin: BMI. – Hansen, Georg (1996): Assimilation und Segregation – das schulorganisatorische Repertoire der deutschen Volkstumspolitik im besetzten Polen 1939-1945. In: Jahrbuch für Pädagogik, Frankfurt/Main: Peter Lang Verlag, S. 197-209. – Hansen, Georg; Wenning, Norbert (2003): Schulpolitik für andere Ethnien in Deutschland. Zwischen Autonomie und Unterdrückung. Münster: Waxmann. – Hubrich, Georg (1927): Die Minderheitenschule. Sammlung der Bestimmungen. Berlin: Weidmannsche Buchhandlung. – Krüger-Potratz, Marianne; Jasper, Dirk; Knabe, Ferdinande (1998): „Fremdsprachige Volksteile und deutsche Schule.“ Schulpolitik für die Kinder der autochthonen Minderheiten in der Weimarer Republik – ein Quellen- und Arbeitsbuch. Münster: Waxmann. – Lukaschek, Hans, in Verbindung mit Peter Fischer und Paul Wienhold (1930): Das Schulrecht der nationalen Minderheiten in Deutschland. Berlin: Reimar Hobbing. – Oenning, Ralf Karl (1991): „Du da mitti polnischen Farben…“ Sozialisationserfahrungen von Polen im Ruhrgebiet 1918-1939. Münster: Waxmann.