Straßenschulen
Weltweit leben und arbeiten viele Millionen Kinder und Jugendliche auf der Straße, mehrheitlich in den Ländern des Globalen Südens. Aber auch in den Industrieländern finden sich vielfältige Ausprägungen der Straßenkindheit. Historisch wurde in Europa überwiegend versucht, solche junge Menschen in (→) Schulen für Vagantenkinder oder in (→) Gefängnisschulen mit Konzepten der Arbeitserziehung wieder ‚sesshaft‘ zu machen und an ein ‚geregeltes‘ Leben zu gewöhnen. Ob es in Deutschland bereits früher Straßenschulen gegeben hat, ist nicht bekannt.
Die Straßenpädagogik wurde insbesondere in Lateinamerika entwickelt, und dort werden in der Straßensozialisation zwei Grundformen unterschieden: Kinder (spanisch niños/niñas), die im informellen Sektor auf der Straße (spanisch calle) arbeiten, aber in einem familiären Zusammenhang in extremer Armut leben (niños/niñas en la calle), und Kinder, die auch auf der Straße schlafen und deren Alltag oftmals durch Prostitution, Drogenhandel und Überfälle gekennzeichnet ist (niños/niñas de la calle). Weitere Ursachen des Straßenlebens sind (Bürger-)Kriege, diese Kinder sind dann sehr häufig traumatisiert (niños/niñas de la guerra). Außerdem gibt es Kinder, die aus Heimen des Militärs oder der Polizei flüchteten und auf die Straße geraten (niños/niñas institutionalizados). [Adick 1997; Liebel 2020]
Aufgrund dieser vielfältigen Sozialisationsbedingungen wurden in Lateinamerika sowie in Afrika und Asien spezifische Konzepte einer Straßenpädagogik entwickelt, die ebenfalls auf zwei Grundtypen rückführbar sind: Mit der einen Strategie wird versucht, die Kinder ‚von der Straße zu holen‘, indem man sie in geschlossenen Einrichtungen unterbringt (Kindergefängnisse, Kinderkliniken) oder die Konzepte an einer Arbeitserziehung ausrichtet (Kinderkolonien), familienanaloge Strukturen bietet (Kinderdörfer) oder auf Partizipation und Selbstverwaltung setzt (Kinderrepubliken). In der anderen Strategie wird dagegen am Straßenleben angesetzt: Manche Projekte zielen auf die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und Arbeitsrechte (Kindergewerkschaften, Kinderbewegungen), andere Angebote basieren auf einer gemeinwesenorientierten ‚Barriopädagogik‘ (Straßenpädagogische Zentren). Oft geht es vor allem um Grundversorgung (Schlafplatz, Duschmöglichkeit, Essen, Ausruhen, Beratung) oder es werden intensive mehrjährige pädagogische Programme angeboten. Manchmal besuchen die Kinder die öffentlichen Schulen oder die Projekte richten eigene Schulen ein, andere bieten ausschließlich informelle Lernangebote an (Calleescuela). Nicht selten sind die verschiedenen Organisationsformen in übergreifende Handlungskonzepte integriert: Nach einer Phase niedrigschwelliger Kontaktaufnahme und Grundversorgung werden Möglichkeiten systematischer schulischer Bildung oder beruflicher Qualifizierung angeboten, oftmals wird das Programm abgeschlossen von einer zunehmend unabhängiger werdenden Nachbetreuung. [Holm/Dewes 1996, Dücker1998, Nnaji 2005]
In Deutschland leben junge Leute frühestens ab dem vierzehnten, häufiger ab dem sechzehnten Lebensjahr auf der Straße, denn das umfassende Kinder- und Jugendhilfegesetz greift zumindest bei Kindern relativ verlässlich, die „Hilfen für junge Volljährige“ (§ 41 SGB VIII) sind demgegenüber wenig verbindlich formuliert. Straßenjugendliche bevorzugen überwiegend Großstädte, aber auch in kleineren Kommunen sind sie zu finden. Straßenkarrieren in Deutschland zeigen ebenfalls große Unterschiede in den sozialen und ökonomischen Bedingungen, unter denen sie sich vollziehen. Geschlechtsspezifische Differenzen, Alter, aufenthaltsrechtlicher Status und Gesundheitszustand sowie die psychische Verfassung sind wichtige Faktoren, die den Weg auf die Straße und den Karriereverlauf beeinflussen. In entsprechenden Typologien werden Jugendliche unterschieden, die zumeist aus akuten familiären Konfliktsituationen von zu Hause weggelaufen sind und sich oftmals nur für kurze Zeit auf der Straße aufhalten (Ausreißer), solche, die sich in ihrer Freizeit in straßenzentrierten Szenemilieus befinden und deren Lebensstil sich durch eine partielle Abkehr von bürgerlichen Lebenskontexten auszeichnet, ohne dass es zu einem vollständigen Bruch mit der Familie kommt (Aussteiger), andere, die in benachteiligten Quartieren aufwachsen, sich durch Cliquenbildungen zunehmend von den Familien distanzieren und sich mit Kleinkriminalität durchschlagen (Entwurzelte). Hinzu kommen solche, die dauerhaft oder jedenfalls für einen längeren Zeitraum ohne festen Wohnsitz und ohne regelmäßige Einkünfte auf der Straße leben und dort oder in halb-öffentlichen Räumen, wie Tiefgaragen, Baustellen oder Schrebergärten übernachten (Treber). Schließlich jene, die aufgrund ihres illegalen Aufenthaltsstatus keinen Zugang zu Wohnraum oder Sozialleistungen haben (Papierlose). Auch zwischen diesen Mustern kann es fließende Übergänge im biografischen Verlauf geben. [DJI 1995, 2014]
Die Straßenpädagogik ist in Deutschland ebenfalls institutionell und konzeptionell ausdifferenziert: Zum einen gibt es die (→) Kinder- und Jugendnotdienste der öffentlichen Jugendhilfe, die nach einer kurzfristigen Notunterbringung eine Rückführung in die Familien intendiert (Schutzstellen, Aufnahmeheime). Die Straßensozialarbeit wird eher stadtteilorientiert organisiert, beispielsweise von einem Jugendzentrum aus (Mobile Jugendarbeit), die aufsuchend und szenenah bzw. zielgruppenorientiert erfolgt (Streetwork), in der Anlaufstellen mit Verpflegungs-, Dusch- und Waschgelegenheiten, Notschlafbetten und Freizeitangeboten geschaffen werden (Kontaktläden, Szenecafés) oder die vor allem Beratung anbietet (Busprojekte). Obwohl Straßenjugendliche in Deutschland sehr häufig unvollständige Schulkarrieren haben, spielen schulische Angebote in der Straßenpädagogik zunächst eine untergeordnete Rolle und kommen erst nach einer Stabilisierung der Lebenslage bzw. der Reintegration in bürgerliche Lebensformen ins Spiel. Es haben sich unterschiedliche Formen von Straßenschulen herausgebildet.
Der älteste Typ ist die sozialpädagogische Straßenschule. Die 1997 initiierte „Freiburger StrassenSchule“ beruft sich in ihrem Konzept explizit auf die lateinamerikanische ‚Calleescuela‘. Sie bietet eine auf Prävention fokussierte dezentrale „WerkstattSchule“ an, die mehreren Förderschulen angegliedert ist und sich an neun- bis dreizehnjährige Kinder richtet, die Gefahr laufen, Straßenkarrieren zu entwickeln. Es werden außerunterrichtliche Lernerfahrungen in Arbeitsprojekten angeboten, wie zum Beispiel die Mithilfe bei der Weinernte, Holzarbeiten im Wald oder die Renovierung eines Bauwagens. Im „Streetwork Projekt“ dagegen versucht man Kontakte zu den verschiedenen jugendlichen Straßenszenen zu knüpfen. In einer Anlaufstelle werden Hilfestellungen mit Behörden gegeben, insbesondere wird die Wohnungssuche unterstützt. In einem Wohnprojekt können bis zu sieben junge Wohnungslose im Alter zwischen 18 bis 27 Jahren unterkommen, in das die jungen Leute auch mit ihren Hunden einziehen dürfen. Die Straßenschule Dresden arbeitet mit einem ähnlichen Ansatz. [Dücker 2001, Wolfer 2018]
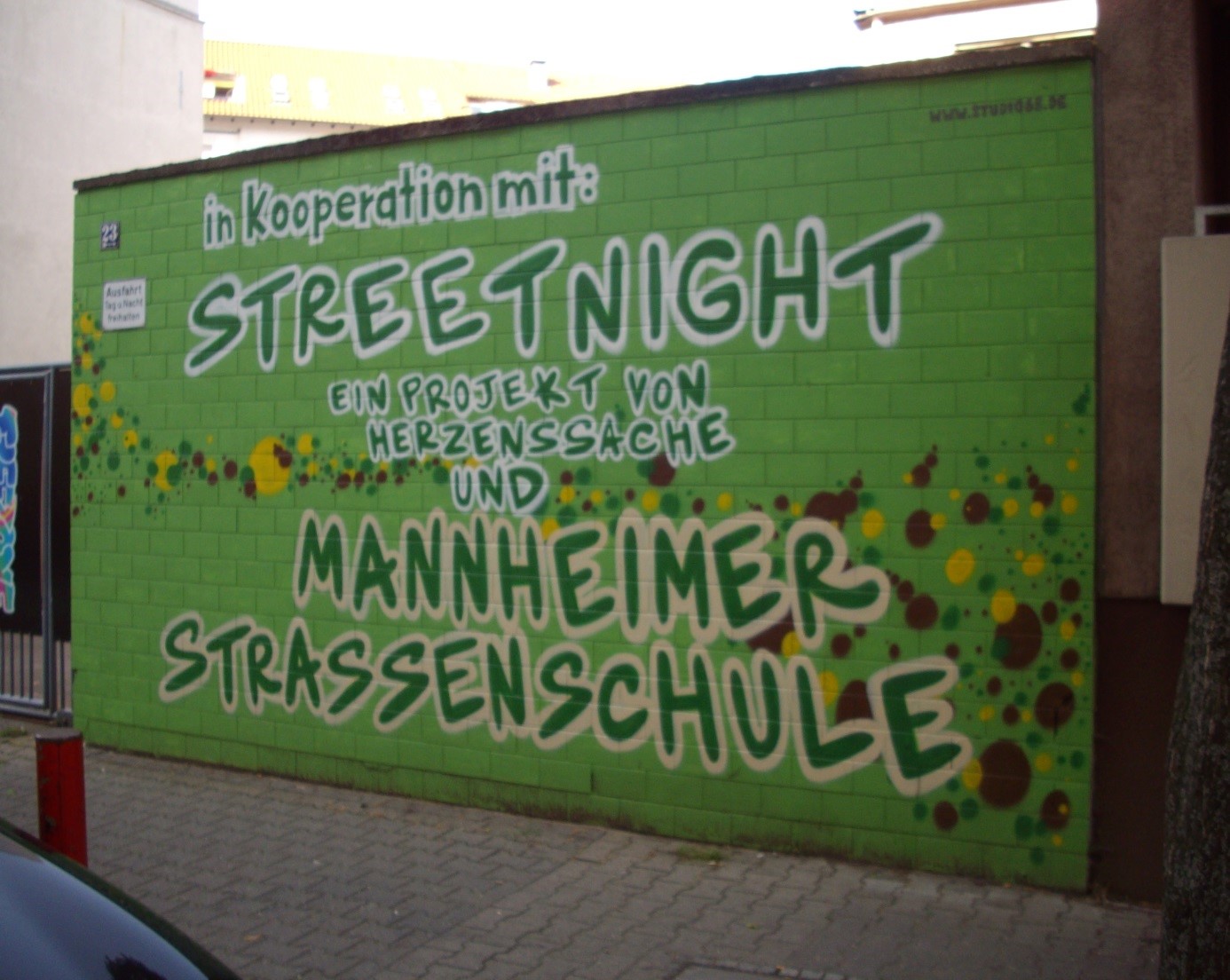
Graffiti am Eingang der Mannheimer Strassenschule [2011; Foto: Schroeder]
Außerdem gibt es abschlussorientierte Straßenschulen. Die „Mannheimer Straßenschule“ wurde 2010 gegründet als Teil einer Anlaufstelle für Jugendliche und junge Erwachsene, die von bestehenden Hilfsangeboten der Jugendhilfe nicht mehr erreicht werden. Die Straßenschule bereitet auf einen schulexternen Haupt- oder Realschulabschluss vor, der einmal jährlich über die Schulfremdenprüfung abgelegt werden kann. Hierfür entwickeln Studierende und Lehrende des Masterstudiengangs Straßenkinderpädagogik der Universität Heidelberg zusammen mit Lehrkräften der Mannheimer Schulen spezielle Bildungsangebote, die auf die Situation der jungen Menschen zugeschnitten sind. Der Unterricht findet an drei Abenden jeweils von 17 bis 20 Uhr statt. Nach ihrem Schulabschluss werden die jungen Menschen weiterhin betreut sowie durch Bewerbungstraining und Kontakte zu Unternehmen bei ihrem Berufseinstieg unterstützt. Ein ebenfalls abschlussorientiertes Konzept in Baden-Württemberg sind die „Straßeneckenschulen“ als Außenstellen von Förderschulen, die dezentrale außerschulische Lernmöglichkeiten anbieten, in denen neben dem schulischen Basiswissen vor allem die unmittelbaren Alltagsprobleme und deren Bewältigung eine große Rolle spielen. Teilweise ist auch die Vorbereitung auf einen Schulabschluss möglich [Schefold 2013].
Eine dritte Form sind niedrigschwellige Lernangebote, wie zum Beispiel der „Hirntoaster“ in Hamburg, eine Einrichtung des Jugendhilfeträgers BASIS e.V., der seit 1987 vor allem männlichen Prostituierten aus dem Bahnhofsmilieu Beratung und Begleitung in einer Anlauf- und einer Übernachtungsstelle sowie vor Ort durch aufsuchende Sozialarbeit anbietet. Mit dem Projekt KIDS („Kinder In Der Szene“) wurde eine weitere Anlaufstelle geschaffen, die sich an Kinder und jüngere Jugendliche richtet. Studierende der Sonderpädagogik der Universität Hamburg und das KIDS-Team führen seit 1997 das Lernprojekt durch, das eigene Räumlichkeiten hat, gleichwohl inmitten der Drogen- und Stricherszene liegt. Neben Angeboten in den Kulturtechniken und PC-Kompetenzen werden verschiedene lebensweltliche Themen bearbeitet (Schutz vor Hepatitis, Ausfüllen von Formularen) sowie Musik-, Sport- und Kunstaktivitäten angeregt. Der niedrigschwellige „Hirntoaster“ will den Kindern und Jugendlichen einen Zugang zu strukturierten Lernprozessen eröffnen, so dass sie das Lernen nicht verlernen. [Pfennig 1996, Metje 2004, Herz 2007].
Adick, Christl (1997): Straßenkinder und Kinderarbeit. Sozialisationstheoretische, historische und kulturvergleichende Studien. Frankfurt/Main: IKO. – DJI (1995): Deutsches Jugendinstitut e.V.: „Straßenkinder“. Annäherungen an ein soziales Phänomen. München/ Leipzig: DJI. – DJI (2014): Deutsches Jugendinstitut e.V.: Straßenkinder und -jugendliche in der Jugendsozialarbeit. Leipzig: DJI. – Dücker, Uwe von (1998): „Straßenschule“. Straßenkinder in Lateinamerika und Deutschland – ein interkultureller Vergleich aus sozial- und entwicklungspolitischer und methodisch-konzeptioneller Sicht. Frankfurt/Main: IKO. – Dücker, Uwe von (Hrsg.) (2001): Straßenkids. Neu lernen in der Freiburger StrassenSchule. Freiburg: Lambertus. – Herz, Birgit (2007): Lernbrücken für Jugendliche in Straßenszenen. Münster: Waxmann. – Holm, Katrin; Dewes, Jürgen (1996): Neue Methoden der Arbeit mit Armen. Am Beispiel Straßenkinder und arbeitende Kinder. Frankfurt/Main: IKO. – Liebel, Manfred (2020): Kindheit und Arbeit. Wege zum besseren Verständnis arbeitender Kinder. Verlag Opladen: Barbara Budrich. – Nnaji, Ina Adora (2005): Ein Recht auf Arbeit für Kinder! Chance zu gesellschaftlicher Partizipation und Gleichberechtigung. Marburg: Tectum-Verlag. – Schefold, Isabell (2013): Impulse aus der pädagogischen Arbeit in Sonderklassen – konkretisiert am Beispiel einer Schule für Erziehungshilfe in Nordwürttemberg. www.opus.bsz-bw.de/hsrt. – Wolfer, Dieter (2018): Straßenpädagogik, der Lernort Straße und Straßenschule. In: Friedrich-Ebert-Stiftung (Hrsg.): Lernort Straße. Dresden: FES, 59-77.